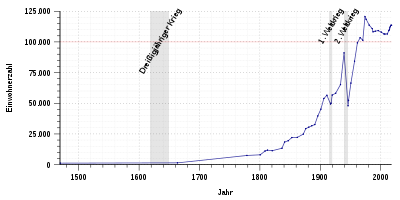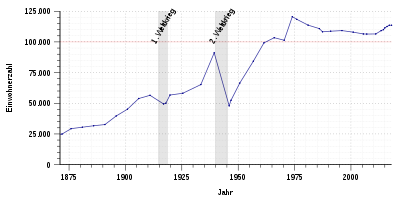Koblenz
| Einwohner | 1'689 |
| Fläche | 4.08km² |
 Kanton: AG
Kanton: AG
Demografie
| 0-19 Jahre | 19,60% |
| 20-64 Jahre | 64,42% |
| 65+ Jahre | 15,99% |
| Ausländer | 42,39% |
| Sozialhilfequote | 3,13% |
Wähleranteile Nationalratswahlen
Willkommen auf der Info Seite der Gemeinde Koblenz
Hier finden Sie alles wissenswertes zur Gemeinde Koblenz im Kanton AG.
Koblenz gehört zum Bezirk Zurzach und hat aktuell 1689 Einwohner.
Haushalte
Im Kapitel "Haushalte" erhalten wir einen Einblick in die Verteilung der Haushalte innerhalb der Gemeinde. Die Analyse der Haushaltsstruktur liefert wichtige Informationen über die Wohnsituation, Familienstrukturen und den sozioökonomischen Status der Bewohner. Durch die Untersuchung der Anzahl und Art der Haushalte können wir ein besseres Verständnis für die Zusammensetzung und Vielfalt der Gemeinde gewinnen.
Die Durchschnittliche Haushaltsgröße, ein wesentlicher Indikator für die Wohnsituation in der Gemeinde, beträgt 2,27. Diese Zahl gibt uns Aufschluss über die Anzahl der Personen, die durchschnittlich in einem Haushalt leben. Eine niedrigere Durchschnittsgröße kann auf kleinere Haushalte oder eine höhere Anzahl von Ein-Personen-Haushalten hinweisen, während eine größere Durchschnittsgröße auf größere Familien oder mehrere Generationen unter einem Dach hindeuten kann. Die Kenntnis der durchschnittlichen Haushaltsgröße ermöglicht es den Gemeindevertretern und Planungsgremien, Ressourcen und Dienstleistungen entsprechend anzupassen und die Bedürfnisse der verschiedenen Haushaltstypen zu berücksichtigen, sei es bei der Wohnungsbereitstellung, der sozialen Unterstützung oder der Infrastrukturentwicklung.
| Haushaltstyp | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Total | 727 | 100% |
| Einpersonenhaushalte | 253 | 34,80% |
| Zweipersonenhaushalte | 248 | 34,11% |
| Dreipersohnenhaushalte | 81 | 11,14% |
| Vierpersonenhaushalte | 93 | 12,79% |
| Fünfpersonenhaushalte | 37 | 5,09% |
| Sechs- und mehrpersonenhaushalte | 15 | 2,06% |
Abstimmungen
Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
| Stimmberechtigte | Abgegebene Stimmen | Gültige Stimmen | Ja | Nein | % Ja |
|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 364 | 363 | 185 | 178 | 50,96% |
Häufige Fragen zu Koblenz
Wieviele Ausländer leben in Koblenz?
42,39% der Bevölkerung welche ständing in Koblenz lebt, sind Ausländer.Geschichte
Geschichte
→ Hauptartikel: Geschichte der Stadt Koblenz
Im Laufe seiner Geschichte gehörte Koblenz zu verschiedenen Staaten und Gebietskörperschaften :
 Die Geschichte der Stadt Koblenz ist sehr wechselhaft und gekennzeichnet von kriegerischen Auseinandersetzungen bei zahlreichen Grenzkonflikten sowie einem großen baulichen Wandel. Bereits seit der Steinzeit
ist das Gebiet von Koblenz besiedelt. Die Römer
bauten hier erstmals eine befestigte städtische Siedlung. Es entstanden im heutigen Altstadtkern das Kastell
Confluentes
zur Sicherung der Römischen Rheintalstraße
(Mainz–Köln–Xanten) und in Niederberg das Kastell Niederberg
zur Sicherung des Limes
sowie erster Brücken über Rhein und Mosel
. Koblenz gehört somit zu den ältesten Städten Deutschlands
. Nach dem Rückzug der römischen Truppen im 5. Jahrhundert wurde Koblenz von den Franken
erobert, die hier einen Königshof
begründeten. In der 836 geweihten Kastorkirche
fanden 842 Verhandlungen zwischen den drei Enkeln Karls des Großen
statt, die schließlich zur Teilung des Fränkischen Reichs im Vertrag von Verdun
843 führten.
Die Geschichte der Stadt Koblenz ist sehr wechselhaft und gekennzeichnet von kriegerischen Auseinandersetzungen bei zahlreichen Grenzkonflikten sowie einem großen baulichen Wandel. Bereits seit der Steinzeit
ist das Gebiet von Koblenz besiedelt. Die Römer
bauten hier erstmals eine befestigte städtische Siedlung. Es entstanden im heutigen Altstadtkern das Kastell
Confluentes
zur Sicherung der Römischen Rheintalstraße
(Mainz–Köln–Xanten) und in Niederberg das Kastell Niederberg
zur Sicherung des Limes
sowie erster Brücken über Rhein und Mosel
. Koblenz gehört somit zu den ältesten Städten Deutschlands
. Nach dem Rückzug der römischen Truppen im 5. Jahrhundert wurde Koblenz von den Franken
erobert, die hier einen Königshof
begründeten. In der 836 geweihten Kastorkirche
fanden 842 Verhandlungen zwischen den drei Enkeln Karls des Großen
statt, die schließlich zur Teilung des Fränkischen Reichs im Vertrag von Verdun
843 führten.
In der folgenden Herrschaft der Erzbischöfe und Kurfürsten von Trier blühte Koblenz weiter auf: Aus der auf dem Ehrenbreitstein um 1020 erbauten Burg entwickelte sich die spätere Festung Ehrenbreitstein . In unsicheren Zeiten wurden hier die wertvollsten Heiligtümer und Unterlagen des Kurstaates aufbewahrt. Im 12. Jahrhundert erbauten die Erzbischöfe von Trier die Florins- und die Liebfrauenkirche . Im 13. Jahrhundert entstanden die Burg Stolzenfels als kurtrierische Zollburg am Rhein sowie die Alte Burg am Moselufer in der Stadt Koblenz als eine Zwingburg gegen die nach mehr Unabhängigkeit strebenden Bürger und Sitz eines Amtmanns. Erzbischof Balduin von Luxemburg ließ mit einer festen Brücke, der Balduinbrücke , erstmals seit den Römern einen festen Moselübergang entstehen. Im Dreißigjährigen Krieg verlegte Kurfürst Philipp Christoph von Sötern seinen Amtssitz von Trier in das neu erbaute Schloss Philippsburg am Fuße des inzwischen zur Festung ausgebauten Ehrenbreitsteins. Im Jahre 1786 zog Kurfürst Clemens Wenzeslaus von Sachsen in das Kurfürstliche Schloss nach Koblenz um. Von hier regierte er den Kurstaat bis zu seinem Ende 1794, als das Land und Koblenz von der französischen Revolutionsarmee erobert wurden. Von 1789 bis 1794 (und danach auf die Festung Ehrenbreitstein bis 1799) hatten sich gegenrevolutionäre Kräfte um die Brüder von Louis XVI. nach Koblenz zurückgezogen und es dank ihres Onkels Wenzeslaus als „Klein-Paris“ relativ selbstständig verwaltet, bis es dann durch Severin Marceau erobert wurde.
Stadtansicht nach Braun und Hogenberg 1572
Die folgende französische Zeit prägte Koblenz (französisch Coblence) weit über deren Ende hinaus. Es entstand der Begriff des Schängel , mit dem bis heute jeder bezeichnet wird, der in Koblenz geboren ist. Im Frieden von Lunéville fiel Koblenz 1801 auch formal an Frankreich und wurde Hauptstadt des französischen Département de Rhin-et-Moselle . Das Ende dieser französischen Zeit kam 1814 mit der Besetzung von Koblenz durch russische Truppen.
Durch den Wiener Kongress 1814/15 gingen die rheinischen Besitztümer des Trierer Kurstaates und damit auch Koblenz auf Preußen über. Die Stadt, zunächst Sitz des Oberpräsidiums der Provinz Großherzogtum Niederrhein , später Hauptstadt der preußischen Rheinprovinz , wurde als Festung Koblenz zu einem der stärksten Festungssysteme in Europa ausgebaut. Im 19. Jahrhundert entstanden nicht nur mächtige Festungswerke in Koblenz, so wurde auch das Schloss Stolzenfels neu aufgebaut und den Rhein überquerte nun eine Schiffbrücke . Die erste Eisenbahn fuhr 1858 über die neu erbaute Moseleisenbahnbrücke in Koblenz ein. Mit dem folgenden Ausbau des Eisenbahnnetzes entstanden mit Bau der Pfaffendorfer Brücke , der Gülser Eisenbahnbrücke und der Horchheimer Eisenbahnbrücke weitere Überquerungen über Rhein und Mosel. Koblenz mit Beginn bzw. Ende der Moselstrecke und der Lahntalbahn lag, mit durchgehender Fertigstellung 1882, an zwei Teilstrecken der Kanonenbahn des Deutschen Kaiserreiches , mit Verbindung von Berlin über Koblenz nach Metz .
Wegen der fortschreitenden Kriegstechnik verloren die Festungen ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an Bedeutung. Seit 1890 brach man die Stadtbefestigung vollständig ab und das Siedlungsgebiet konnte nun erstmals über die engen Stadtgrenzen hinaus erweitert werden. Zu Ehren Kaiser Wilhelms I. , der mit seiner Gattin Augusta vor seiner Thronbesteigung lange in Koblenz gelebt hatte, wurde 1897 in Anwesenheit Kaiser Wilhelms II. an der Moselmündung das Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck eingeweiht.
Das 20. Jahrhundert war von großen baulichen Veränderungen sowie einer erheblichen Erweiterung des Siedlungsgebiets geprägt. So wurde an der Stelle des ehemaligen Löhrtors 1903 die Herz-Jesu-Kirche eingeweiht. Bereits ein Jahr zuvor wurde in der neuen Südlichen Vorstadt ein prächtiger Hauptbahnhof fertiggestellt. Nach Ende des Ersten Weltkrieges wurde Koblenz erst von amerikanischen und dann von französischen Truppen besetzt . Im Jahre 1932 begann der völlige Umbau der Pfaffendorfer Brücke, aus der ein kompletter Neubau zu einer Straßenbrücke hervorging. Zwei Jahre später folgte die Einweihung einer neuen Moselüberquerung , da die Balduinbrücke dem wachsenden Verkehrsaufkommen nicht mehr genügte.
Das zerstörte Koblenz 1945
Einschneidend waren im Zweiten Weltkrieg die Luftangriffe auf Koblenz , bei denen die Stadt zu 87 % zerstört wurde. 1944 legten Lancaster-Bomber der britischen Royal Air Force das Zentrum von Koblenz in Schutt und Asche. Am 18. und 19. März 1945 nahm die 87. US-Infanteriedivision der US Army Koblenz ein.
Langsam erholte sich die Stadt von den Kriegsereignissen, das historische Stadtbild bleibt aber teilweise verloren. In der Nachkriegszeit kam Koblenz zur Französischen Besatzungszone und infolgedessen zum neuen Land Rheinland-Pfalz . In den Anfangsjahren war es zudem dessen vorläufiger Regierungssitz. Auf der Rittersturz-Konferenz 1948 wurde eine der grundsätzlichen Entscheidungen für den Zusammenschluss der drei westlichen Besatzungszonen („ Trizone “) zur Bundesrepublik Deutschland und damit für die einstweilige Trennung von der Sowjetzone getroffen. Infolge der westdeutschen Wiederbewaffnung seit Mitte der 1950er Jahre erhielt Koblenz erneut eine sehr große deutsche Garnison . Die letzten Teile der französischen Garnison zogen 1969 ab. Koblenz überschritt 1962 die Marke von 100.000 Einwohnern und wurde damit Großstadt . Ein großes Brückenbauprojekt wurde mit Vollendung der Südbrücke 1975 abgeschlossen. Beim Bau der Rheinbrücke kam es zu zwei tragischen Unfällen, bei denen 19 Arbeiter den Tod fanden. Im Jahr 1992 konnte die Stadt Koblenz den 2000. Jahrestag der Stadtgründung feiern.
Am 4. Dezember 2011 mussten etwa 45.000 Einwohner ihre Wohnungen verlassen . Der Grund für die bis dahin umfangreichste Evakuierung einer deutschen Großstadt nach 1945 war die Entschärfung einiger Kampfmittel ; darunter war eine britische Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg.
Eingemeindungen
Ehemals selbstständige Gemeinden und Gemarkungen, die in die Stadt Koblenz eingegliedert wurden:
Jahr
Orte
Zuwachs
in ha
Jahr
Orte
Zuwachs
in ha
1. Juli 1891
Neuendorf mit Lützel
547
7. Juni 1969
Kesselheim
484
1. April 1902
Moselweiß
382
7. Juni 1969
Kapellen-Stolzenfels
248
1. Oktober 1923
Wallersheim
229
7. November 1970
Arenberg-Immendorf
900
1. Juli 1937
Ehrenbreitstein
120
7. November 1970
Arzheim
487
1. Juli 1937
Horchheim
772
7. November 1970
Bubenheim
314
1. Juli 1937
Metternich
483
7. November 1970
Güls mit Bisholder
795
1. Juli 1937
Niederberg
203
7. November 1970
Lay
249
1. Juli 1937
Pfaffendorf mit Asterstein
369
7. November 1970
Rübenach
1288
Einwohnerentwicklung
Einwohnerentwicklung von Koblenz. Oben ab 1469 bis 2017. Unten ein Ausschnitt ab 1871
Bevölkerungspyramide für Koblenz (Datenquelle: Zensus 2011.)
Durch zahlreiche Eingemeindungen verdoppelte sich die Bevölkerung der Stadt von 45.000 im Jahre 1900 auf 91.000 im Jahre 1939. Im Zweiten Weltkrieg verlor Koblenz aufgrund der fast vollständigen Zerstörung der Stadt rund 80 % seiner Einwohner. Im April 1945 wurden im gesamten Stadtgebiet 19.076 Kartenempfänger durch das Ernährungsamt ermittelt. 1958 erreichte die Bevölkerungszahl wieder den Vorkriegsstand. 1961 überschritt die Einwohnerzahl der Stadt die Grenze von 100.000, was sie zur Großstadt machte.
Am 7. November 1970 stieg die Bevölkerungszahl der Stadt durch die Eingemeindung mehrerer Ortschaften um knapp 20.000 Personen auf rund 120.000 Einwohner – historischer Höchststand. 2004 betrug der Anteil der nichtdeutschen Bewohner an der Gesamtbevölkerung nach Angaben der Stadtverwaltung 9,3 % (10.021 Personen). Den größten Anteil daran stellen Mitbürger aus der Türkei (1963), der Ukraine (872), Serbien und Montenegro (785) sowie Russland (711). Ende Juni 2005 lebten in Koblenz nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz 106.501 Menschen mit Hauptwohnsitz . Danach vor allem nach Abschluss der Bundesgartenschau 2011 stieg die Einwohnerzahl wieder stetig an und überschritt am 31. Mai 2014 die 110.000er Marke, so hoch wie seit 1992 nicht mehr. Dieser Trend hielt auch die kommenden Jahre an, laut Statistischem Landesamt hatte Koblenz zum Jahresende 2020 rund 113.000 Einwohner mit Hauptwohnsitz.
Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1833 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der jeweiligen Statistischen Ämter beziehungsweise der Stadtverwaltung selbst. Die Angaben beziehen sich ab 1843 auf die „Ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1987 auf die „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“. Vor 1843 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.
Jahr
Einwohner
1469
1.193
1663
1.409
1778
7.475
1800
7.992
1808
11.077
1812
11.793
1820
11.324
1836
13.307
1. Dezember 1840 ¹
18.387
3. Dezember 1846 ¹
19.475
3. Dezember 1852 ¹
22.033
3. Dezember 1861 ¹
22.175
1. Dezember 1871 ¹
24.902
1. Dezember 1875 ¹
29.300
Jahr
Einwohner
1. Dezember 1880 ¹
30.500
1. Dezember 1885 ¹
31.669
1. Dezember 1890 ¹
32.664
2. Dezember 1895 ¹
39.639
1. Dezember 1900 ¹
45.147
1. Dezember 1905 ¹
53.897
1. Dezember 1910 ¹
56.487
1. Dezember 1916 ¹
49.421
5. Dezember 1917 ¹
50.067
8. Oktober 1919 ¹
56.676
16. Juni 1925 ¹
58.161
16. Juni 1933 ¹
65.257
17. Mai 1939 ¹
91.098
31. Dezember 1945
47.982
Jahr
Einwohner
29. Oktober 1946 ¹
52.414
13. September 1950 ¹
66.444
25. September 1956 ¹
84.275
6. Juni 1961 ¹
99.240
31. Dezember 1965
103.425
27. Mai 1970 ¹
101.374
31. Dezember 1973
120.564
31. Dezember 1975
118.394
31. Dezember 1980
113.676
31. Dezember 1985
110.843
25. Mai 1987 ¹
108.246
31. Dezember 1990
108.733
31. Dezember 1995
109.219
31. Dezember 2000
107.950
Jahr
Einwohner
30. Juni 2005
106.501
31. Dezember 2006
106.421
31. Dezember 2010
106.501
9. Mai 2011 ¹
107.825
31. Mai 2013
109.209
31. Mai 2014
110.002
31. Dezember 2014
111.434
31. Dezember 2015
112.586
31. Dezember 2016
113.605
31. Dezember 2017
113.844
31. Dezember 2020
113.388
31. Dezember 2021
113.638
¹ Volkszählungsergebnis